
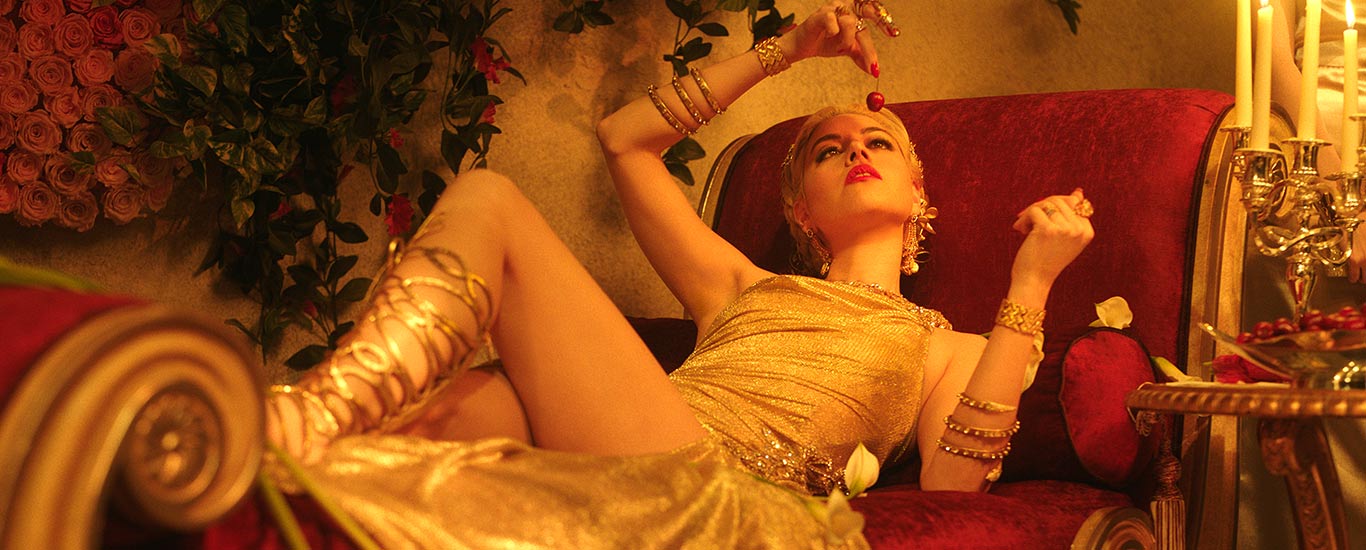
Wer hat wozu und wieso überhaupt Hass? Mit dem Lieblingsthema vieler Politiker beschäftigen sich Gott sei Dank auch Leute, die etwas näher dran sind und die einen Unterschied machen können – Polizisten zum Beispiel. Marvin Gamisch arbeitet bei der Polizei in Frankfurt, um seinen Kollegen Orientierung bei Hass und Hetze zu bieten.
Da Sonntagsreden dabei kaum aushelfen, bedient er sich in der Forschung bei Gordon Allports Definition von Vorurteilen und den Arbeiten von Andreas Zick und Beate Küpper, die in Bielefeld zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit forschen. Die Mitte-Studie der Ebert-Stiftung nennt er. Wilhelm Heitmeyers Zwiebelmodell, das die Eskalation von alltäglichen Vorurteilen zu Kriminalität und Terrorismus beschreibt.
Die Polizei lud heute in ihr Präsidium ein, damit auch wir Normalos mal hören können, womit sich die Polizei so befasst.

Nicht verwunderlich kennt der Hass viele Facetten. Man sieht es schon in der Grafik, es ist nicht alles immer nur Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus und Antisemitismus. Auf dem Radar hat die Polizei auch Abwertungen langzeitarbeitsloser und wohnungsloser Menschen. Das, kategorisiert Gamisch, spiele sich in der Dimension des Klassismus ab.

Der hatte in der Kategorienübersicht einen von vier Plätzen zugewiesen bekommen, neben Sexismus, Rassismus und Antisemitismus, die viel häufiger diskutiert werden. Klassismus ist demnach, wenn man über Obdachlose und Bettler jammert. Auf der Folie war nur Platz für eine, wohl die plakativste Aussage.

Interessant ist aber doch die Richtung. Sexismus ist eher der Hass von Männern auf Frauen. Antisemitismus ist der Hass gegen Juden. Rassismus ist der Hass gegen Fremde. Und Klassismus? Ist er einfach nur der Hass der Ärmsten auf die Allerärmsten? Die Diskursarenen kennen immer zwei Seiten, beispielsweise bei Steffen Mau, der die derzeit prominenteste und brauchbarste Arenenkartographie mit einer Ökonomie-Arena „oben/unten“ beschreibt. Aber wo ist auf der Straße eigentlich oben und unten – gerade in Frankfurt am Main?

Die demoskopischen Fragen lauten: „Langzeitarbeitslose machen sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben.“; „Empfänger von Sozialhilfe und Bürgergeld neigen zu Faulheit.“; „Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden.“; „Für Behinderte wird in Deutschland zu viel Aufwand betrieben.“
In der Stadt werden regelmäßig Wohnungen im zweistelligen Millionenbereich verhökert und Gebäude im Milliardenbereich. In den Schaufenstern liegen Uhren im sechsstelligen Bereich ausgestellt. Privatflugzeuge starten über die Stadt. Im Fernsehen wird dann aber allen der enge Gürtel abverlangt. Der Klassismus spielt sich nicht nur in Frankfurt offenbar nur in der Arena „unten/nichts“ ab.

Wahrscheinlich liegt dieser Umstand, dass der Klassismus als ideologische Grundlage für Hass nur die Blickrichtung abwärts kennt, nicht an den Forschern, sondern an ihren Probanden – also uns. Wer hasst schon Menschen in tollen Klamotten, mit hübschen Uhren oder aufregenden Urlaubsreisen. Auch wenn man sich nicht zu ihnen zählt, erfreut man sich doch an ihnen im Stadtbild.
Hört man jedoch, was Gamisch zu den Grundlagen des Hasses im Alltag sagt, stellen sich doch ein paar Fragen. Er ging die Funktionsweisen und ihre treibenden Mythen durch, die den Hass befeuern: Wir erfahren eine „kognitive Entlastung“, wenn wir unseren Mangel an Wünschenswertem und Zufriedenheit damit erklären, dass jemand anders ungerechtfertigt viel mehr habe. Unsere Identität entsteht, indem wir uns in Relation zu anderen sehen. Gerade in Krisenzeiten werde alles in einem „Sündenbock-Mechanismus“ verpackt, um Verantwortlichkeiten so zu verteilen, dass man mit sich im Reinen sein kann. Wenn dann noch „politische Akteure öffentlich Vorurteile legitimieren und sagen, ja also da ist schon was dran“, stehe dem Hass alles offen. Es wird dann alles nur eine Frage der Rezeptur.

Man sieht es auf Gamischs interessanter Folie. Die sogenannte Mitte ist die äußere Schicht. Dort zeigt zwar die Mitte-Studie, nehmen extremste Ansichten gerade wieder ab, aber „was immer mehr auffällt in den Studien, dass diese teils, teils Antworten immer größer werden. Das heißt, die Leute sagen nicht explizit, ja, das sehe ich genauso, aber sie sagen, das kommt schon irgendwie hin. Das heißt auch, dass diese Einstellungen natürlich mehr normalisiert werden, weil sie nicht mehr auf explizite negative Bewertung oder Ablehnung treffen.“ Dann beschreibt er mögliche Eskalationsgeschichten und wiederholt es noch einmal.
„Wie gesagt, das Problem ist, dass diese Teils-Teils-Antworten sehr, sehr stark steigen.“
Dann allerdings, zum Ende, und das ist aus immer mehr Anlässen zu kritisieren, veranschaulichte er all das an einem gewählten Beispiel, das vielleicht gar nicht verspricht, was es hält. „So, kurz mal durchatmen, jetzt sind wir beim Antisemitismus, der, wie gesagt, nur eine bestimmte Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist, den ich jetzt mal hier rausgegriffen habe, weil er so ziemlich die älteste und resistenteste Form ist in Europa und in Deutschland.“
Das stimmt soweit. Aber vielleicht ist er genau deswegen gar nicht so anschaulich. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat USAID gecancelt und ist damit verantwortlich für hunderttausende unnötige Todesfälle unter den ärmsten auf der Welt. Der amerikanische Präsident schmückt sich in Gold und Marmor, während seine Landsleute millionenfach an der Tafel leer ausgehen. Tucker Carlson sitzt auf der Bühne und sagt: Man habe nun jeden Zaubertrick einmal angewandt, aber jetzt scheint es unvermeidbar: Der kommende Kulturkrieg dreht sich um arm und reich.
All das verweist auf kaum eine Geschichte. Wie man am Vortrag heute sah, fehlt ein Forschungsstand und eine Sehgewohnheit. Allerdings sagen wir doch seit Ewigkeiten, es stimmt eigentlich immer: „Heute in Amerika, morgen bei uns.“
Leute sind unzufrieden und weder die Beobachtung von Sexismus noch von Rassismus und erst recht nicht von Antisemitismus kann uns beschreiben, was sich gerade Bahn bricht.

Dann zum Schluss bog Gamisch geradewegs auf den Holzweg ab, den wir im Salon bereits befürchtet haben. Ja, Andreas Reckwitz hat ein Buch über „Verlust“ geschrieben. Aber, nein, in ihm spielt das Ökonomische überhaupt keine Rolle. Der Autor hat es nicht nur übersehen, sondern bewusst ausgeblendet. Es taugt als Grundlage für die neue Unzufriedenheit und den kommenden Hass überhaupt nicht. Man sollte es in der Praxis – bei der Polizei oder in der Politik – einfach nicht verwenden.
Zwei andere Bücher sind wichtig. Zum einen Nils Kumkars „Polarisierung“. Darin formuliert er zumindest das Desiderat:
„Selbstverständlich bietet dieses Kapitel keine umfassende Theorie des Rechtspopulismus. Die müsste neben der Transformation der Klassenstruktur der betreffenden nationalen Gesellschaften mindestens auch die veränderten Kommunikations- und Organisationsstrukturen der politischen Öffentlichkeit, die Renationalisierung der Geopolitik und nicht zuletzt die historische Spezifik der liberalen Demokratie umfassen, die als idealisierte Selbstbeschreibung und als institutionelles Ensemble den Gegenpol des Rechtspopulismus bildet, so dass sich das eine ohne das andere kaum charakterisieren lässt. Ganz zu schweigen von den jeweiligen Besonderheiten, die als Gelegenheitsfenster für diese Strategie zum Beispiel in den USA und Deutschland fungierten.“
Nils Kumkar, Polarisierung
Wir brauchen eine Theorie des Rechtspopulismus – der als Anker längst in die „teils, teils“-Bevölkerung geworfen wurde. Diese Theorie taugt allerdings nur, wenn sie die Transformation der Klassenstruktur unhintergehbar zum Ausgangspunkt nimmt.
Zum anderen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey „Zerstörungslust“. Sie legen den Finger in die Wunde der Demoskopie:
„So viel die interviewten Personen alle möglichen politischen und gesellschaftlichen Akteure und Fehlentwicklungen kritisieren, bleibt ein Aspekt davon fast vollständig verschont: der Kapitalismus.“
Amlinger/Nachtwey, Zerstörungslust
Es nützt nichts, noch eine Sonntagsrede und noch ein Fallbeispiel und noch eine Besorgtheit zu formulieren. Antisemitismus ist heute zunehmend ein Begriff der Verlegenheit und der Vermeidung. Man will nochmal eine Sorge äußern und nimmt das einzige Pflaster, auf dem man nicht ausrutschen kann. Heißt aber im Umkehrschluss: Wer die Gegenrede zur staatstragenden Sonntagsrede hält, sich also antisemitisch äußert, will damit vielleicht vor allem dem Staat eins auswischen, der sich nicht mehr traut, neue, drängende Sorgen aufzugreifen. Also, ja, Antisemitismus ist ein ernstes Problem. Noch viel gegenwärtiger als viele derzeit glauben.
Bild: Megalopolis
Hinweis: Wir haben die drei genannten Bücher jeweils 2 Stunden im Salon besprochen.
Sehr gut. Lese auch gerade Amlinger/Nachtwey … vorher schon Hanno Sauer, der ein sehr klares Verständnis auf das Thema „Klasse“ verschafft. (Klasse. Die Entstehung von Oben und Unten. Piper, München 2025, ISBN 978-3-492-07141-3.) Ergänzt Deinen Text gut. Wolfgang M. Schmidt wird bei Schampus allerdings seufzen, dass Klassismus nicht allein durch das Singen der Internationale bekämpft werden kann. Weiter so, ich liebe Deinen klaren Blick auf die Dinge.
Es geht ja auch nicht darum Klassismus zu bekämpfen, sondern Klassen abzuschaffen. Dann wird dieser Form der Diskriminierung komplett die Basis entzogen. 😉
Aber ja, der Klassenkampf mit Schampus wirkt meist nicht so ganz überzeugend.
Ich habe gerade keine Assoziation zu Methoden. Wie schafft man Klassen ab? Also die Idee der Sozialpädagogik der 70er, dass Bildung und Selbstermächtigung Klassenbewusstsein schafft, um es dann zu überwinden?
Nenne mir gerne Literatur zum Kontext. Viele Grüße
Schreibe einen Kommentar zu Christian Grätsch Antwort abbrechen